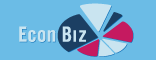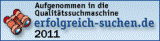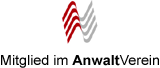- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 18.01.2006, 7 AZR 191/05
| Schlagworte: | Befristung | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 7 AZR 191/05 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 18.01.2006 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Leipzig, Urteil vom 16.12.2003, 8 Ca 5513/03 Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 8.06.2004, 7 Sa 51/04 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
7 AZR 191/05
7 Sa 51/04
Sächsisches
Landesarbeitsgericht
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
18. Januar 2006
URTEIL
Schiege, Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
In Sachen
Beklagter, Berufungskläger und Revisionskläger,
pp.
Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionsbeklagter,
hat der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. Januar 2006 durch den Vizepräsidenten des Bundesarbeitsgerichts Dör-ner, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Gräfl und den Richter am Bundesarbeitsge¬richt Dr. Koch sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Gerschermann und Busch für Recht erkannt:
- 2 -
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Sächsischen Landesarbeitsgerichts vom 8. Juni 2004 - 7 Sa 51/04 - aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit der Befristung einer Arbeitszeiterhöhung.
Der Kläger ist seit dem 1. August 1988 bei dem beklagten Land und dessen Rechtsvorgänger als Lehrer an der Schule, einer Mittelschule, in L beschäftigt. Nach dem Änderungsvertrag vom 29. August 1991 war der Kläger vollbeschäftigter Angestellter.
Am 15. Juni 1992 schloss das beklagte Land mit dem Landesverband Sachsen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine „Vereinbarung über die freiwillige Teilzeitbeschäftigung von Lehrkräften und Erziehern“. Diese lautet auszugsweise:
„Präambel
Gemeinsames Ziel der Partner dieser Vereinbarung ist es, den auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses über die Schulentwicklungsplanung vom 5.5.1992 erforderlichen Stellenabbau auf 42.250 incl. 750 KW-Stellen bis zum 31.12.1992 bei Lehrern und Erziehern sozial verträglich und bei weitestgehender Sicherung der Arbeitsplätze zu gestalten.
Ergänzend hierzu und in Umsetzung des Teilzeitbeschäftigungsmodells besteht zwischen den Parteien dieser Vereinbarung Übereinstimmung dahingehend,
...
- daß für Lehrkräfte, die im Interesse der Arbeitsplatzsicherung ein Teilzeitangebot annehmen, eine spätere Verbeamtung nicht ausgeschlossen ist,
- daß Lehrer für untere Klassen/Grundschullehrer bei entsprechender Eignung in den Klassen 5 und 6 der Mittelschule unterrichten können,
- daß nach Möglichkeit Entlassungen von Teilzeitbeschäftig-
- 3 -
ten auch nach Ablauf des nachstehenden Kündigungsschutzes vermieden werden,
- daß zusätzlich freiwerdende Stellen neben dem Abbau von KW-Stellen, der Schaffung eines Einstellungskorridors für Lehramtsabsolventen und der Deckung des besonderen fachspezifischen Bedarfs auch zu einer Erhöhung des Beschäftigungsumfangs verwendet werden können.
...1. Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt für alle in allgemein- und berufsbilden-den Schulen ... tätigen Lehrkräfte..., die sich am 31.5.1992 in einem entsprechenden Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen befanden ...2. Teilzeitbeschäftigung
2.1. Angestellten, die vom Geltungsbereich dieser Vereinbarung erfaßt werden, ist zur Vermeidung von ordentlichen Kündigungen wegen mangelnden Bedarfs, bei ersatzloser Auflösung der Beschäftigungsstelle, bei Verschmelzung, Eingliederung und bei wesentlicher Änderung des organisatorischen Aufbaus der Beschäftigungsstelle sowie bei anderen dringenden betrieblichen Erfordernissen eine Minderung des Beschäftigungsumfanges im Wege einer Teilzeitbeschäftigung anzubieten. Die Minderung des Beschäftigungsgrades darf 50 v. H. eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers nicht übersteigen. Maßgeblich hierfür ist das jeweils geltende Regelstundenmaß ...3. Kündigungsschutz
3.1. Während der Zeitdauer der unter Ziffer 2 bestimmten Teilzeitbeschäftigung und derselben Zeitdauer nach Ablauf dieser Teilzeitbeschäftigung, höchstens jedoch für einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren nach Abschluß des Änderungsvertrages ... ist eine ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber aus den Kündigungsgründen der Ziffer 2.1. ausgeschlossen. Voraussetzung ist jedoch, daß der Beschäftigungsumfang 82,5 v. H. eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Angestellten nicht überschreitet.
...
- 4 -
5. Übergang zur Vollzeitbeschäftigung
5.1. Den vom Geltungsbereich dieser Vereinbarung erfaßten Angestellten, die sich in einer unter Ziffer 2 bezeichneten Teilzeitbeschäftigung befinden, ist der Übergang zu einem höheren Beschäftigungsgrad anzubieten, wenn hierfür ein dienstlicher Bedarf besteht und eine Planstelle zur Verfügung steht...“Am 25. Juni 1992 unterzeichneten die Parteien einen „Änderungsvertrag für 4 angestellte Lehrkräfte/Erzieher“, in dem es ua. heißt:
㤠1
Ab dem 01.08.1992 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 82,5 v. H. eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers, d. h. 22 Wochenstunden.
§ 2
Wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist die Vereinbarung nebst Anlagen zwischen dem Freistaat Sachsen und der GEW Sachsen über die freiwillige Teilzeitbeschäftigung von Lehrkräften und Erziehern vom 15.6.1992“.
Am 6. September 1993 schlossen die Parteien einen weiteren Änderungsvertrag, wonach der Kläger mit Wirkung vom 1. Juli 1993 als nicht vollbeschäftigter Arbeitnehmer mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 25/27 Stunden beschäftigt wurde. Durch Änderungsvertrag vom 22. April 1998 wurde für die Zeit vom 27. April 1998 bis zum 31. Juli 1998 eine Aufstockung des Unterrichtsdeputats um zwei Unterrichtsstunden vereinbart. Mit Änderungsvertrag vom 7. Dezember 1999 vereinbarten die Parteien für die Zeit vom 1. Oktober 1999 bis zum 12. Juli 2000 eine Aufstockung der wöchentlichen Unterrichtsstunden um eine Stunde auf 26 Stunden. Durch weitere Änderungsverträge vom 11. August 2000 und vom 22. Mai 2001 vereinbarten die Parteien für die Zeit vom 1. August 2000 bis zum 31. Juli 2001 und für die Zeit vom 1. August 2001 bis zum 31. Juli 2002 die befristete Aufstockung des Unterrichtsdeputats auf 27 Stunden.
Am 13. März 2002 beantragte der Kläger mittels eines vom Beklagten gefertigten Formulars die befristete Aufstockung seiner Unterrichtsverpflichtung für das Schuljahr 2002/2003 um zwei Stunden pro Woche. Am 8. Mai 2002 schlossen die Parteien einen „Änderungsvertrag für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis“.
- 5 -
Dieser lautet auszugsweise:
„Änderungsvertrag
für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis
...§ 1
Die bisherige Arbeitszeitvereinbarung wird wie folgt ergänzt:
Herr D wird als vollbeschäftigte Lehrkraft beschäftigt.
Das Regelstundenmaß ist in der Verwaltungsvorschrift zur Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 02.07.1992, in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt geändert am 20.08.1993, festgelegt.
§ 2
Die Lehrkraft wird bezüglich der 2 befristet aufgestockten Unterrichtsstunden auf eigenen Wunsch und auf Grund des bis zum Ende des Schuljahres 2002/2003 bestehenden fachspezifischen Bedarfs auf einer derzeit unbesetzten und künftig wegfallenden Haushaltsstelle beschäftigt.
§ 3
Dieser Änderungsvertrag tritt mit Wirkung vom 01.08.2002 in Kraft und ist bis zum 31.07.2003 befristet.“
Mit der am 18. Juli 2003 beim Arbeitsgericht eingegangenen Klage hat der Kläger die Unwirksamkeit der Befristung der in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarten Arbeitszeiterhöhung um zwei Wochenstunden geltend gemacht. Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Befristung der Vollzeitbeschäftigung zum 31. Juli 2003 sei unwirksam, da sie nicht durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sei. Ein zusätzlicher Unterrichtsbedarf habe in den von ihm unterrichteten Fächern nicht nur vorübergehend bestanden. Dem Regionalschulamt Leipzig seien entsprechende Stellen zugewiesen worden.
Der Kläger hat beantragt,
1. festzustellen, dass zwischen den Parteien über den 31. Juli 2003 hinaus ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung des Klägers besteht;
2. den Beklagten zu verurteilen, den Kläger über den 31. Juli 2003 hinaus für die Dauer des Rechtsstreits als Lehrer zu im übrigen unveränderten Bedingungen weiterzubeschäftigen.
- 6 -
Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen. Nach Verkündung des Berufungsurteils schloss der Beklagte am 21. Juni 2005 mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Bezirkstarifvertrag zur Regelung von besonderen regelmäßigen Arbeitszeiten für angestellte Lehrkräfte der allgemeinbildenden Gymnasien und der Mittelschulen im Freistaat Sachsen. Dieser sieht eine Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 85 % für das Schuljahr 2005/2006, auf 77 % vom Schuljahr 2006/2007 bis zum Schuljahr 2008/2009 und danach auf 79 % vor. Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter. Der Kläger beantragt die Zurückweisung der Revision.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Landesarbeitsgericht. Mit der vom Landesarbeitsgericht gegebenen Begründung kann der Klage nicht stattgegeben werden. Das Landesarbeitsgericht hat die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung der Erhöhung des Unterrichtsstundendeputats für die Zeit vom 1. August 2002 bis zum 31. Juli 2003 zu Unrecht einer Befristungskontrolle nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur Wirksamkeit der Befristung einzelner Vertragsbedingungen nach der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Rechtslage unterzogen und die Befristung mangels eines sie rechtfertigenden Sachgrunds für unwirksam gehalten. Die Befristung wurde nach In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts am 1. Januar 2002 vereinbart und unterliegt daher der Inhaltskontrolle nach §§ 305 ff. BGB in der seit diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. Ob die Befristung der Arbeitszeiterhöhung hiernach wirksam ist, kann der Senat nicht abschließend entscheiden. Dazu bedarf es weiterer tatsächlicher Feststellungen durch das Landesarbeitsgericht.
A. Die Klage ist zulässig.
I. Der Kläger hat sein mit dem Klageantrag zu 1) verfolgtes Klagebegehren zutreffend nicht mit einer Befristungskontrollklage nach § 17 Satz 1 TzBfG geltend gemacht, sondern im Wege einer allgemeinen Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1
- 7 -
ZPO. Der Kläger wendet sich nicht gegen eine Befristung seines gesamten Arbeitsvertrags, sondern gegen die Befristung der Erhöhung der Arbeitszeit auf eine Vollzeitbeschäftigung bis zum 31. Juli 2003. Dies ergibt sich trotz der missverständlichen Formulierung des Klageantrags zu 1) aus der zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehenden Klagebegründung. Auf die Kontrolle der Befristung einzelner Arbeitsbedingungen findet § 17 Satz 1 TzBfG keine Anwendung (BAG 14. Januar 2004 - 7 AZR 213/03 - BAGE 109, 167 = AP TzBfG § 14 Nr. 10 = EzA TzBfG § 14 Nr. 8, zu I der Gründe; 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, auch zur Veröffentlichung vorgesehen <zVv.>, zu A I der Gründe).
II. Mit dem Klageantrag zu 1) macht der Kläger nach der Klagebegründung ausschließlich die Unwirksamkeit der Befristung der Arbeitszeiterhöhung um zwei Unterrichtsstunden auf eine Vollzeitbeschäftigung zum 31. Juli 2003 geltend. Vom Streit der Parteien nicht erfasst ist die Frage, ob und inwieweit sich der Umfang eines Vollzeitarbeitsverhältnisses auf Grund des am 21. Juni 2005 abgeschlossenen Bezirkstarifvertrags zur Regelung von besonderen regelmäßigen Arbeitszeiten für Lehrkräfte der all-gemeinbildenden Gymnasien und der Mittelschulen im Freistaat Sachsen ändert. Diese Frage ist auch deshalb nicht Gegenstand des Klagebegehrens, weil die im Rahmen einer allgemeinen Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO getroffenen Feststellungen auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung der Tatsacheninstanz begrenzt sind. Danach erfolgende, das Rechtsverhältnis betreffende Änderungen werden von der materiellen Rechtskraft des Feststellungsurteils nicht erfasst (BAG 10. Oktober 2002 - 2 AZR 622/01 - BAGE 103, 84 = AP KSchG 1969 § 4 Nr. 49 = EzA KSchG § 4 nF Nr. 64, zu B I 2 b aa der Gründe; 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40 zVv., zu A II der Gründe). Der Bezirkstarifvertrag wurde erst nach der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht abgeschlossen. Dadurch möglicherweise eintretende Änderungen des Beschäftigungsumfangs des Klägers sind daher für die Entscheidung des Senats unerheblich.
III. Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben, da der Beklagte den unbefristeten Fortbestand des Arbeitsverhältnisses des Klägers als Vollzeitarbeitsverhältnis über den 31. Juli 2003 hinaus in Abrede stellt.
B. Ob die Klage begründet ist, kann nicht abschließend entschieden werden. Die Beurteilung der Frage, ob die Befristung der Arbeitszeiterhöhung um zwei Unterrichtsstunden pro Woche zum 31. Juli 2003 wirksam ist, erfordert weitere tatsächliche Fest-
- 8 -
stellungen seitens des Landesarbeitsgerichts. Zur Wirksamkeit der Befristung ist entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts kein Sachgrund iSd. bisherigen, für die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen vor in Kraft Treten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts am 1. Januar 2002 bestehenden Rechtsprechung erforderlich. Die Befristung der Arbeitszeiterhöhung unterliegt vielmehr der allgemeinen zivilrechtlichen Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB. Die Befristung wurde in einem für eine Vielzahl von Lehrkräften von dem Beklagten verwendeten Formularvertrag vereinbart. Bei der Befristung handelt es sich daher um eine Allgemeine Geschäftsbedingung iSv. § 305 Abs. 1 BGB, die der gerichtlichen Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB unterliegt. Ob die Befristung der Arbeitszeiterhöhung zum 31. Juli 2003 der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhält, kann anhand der bislang vom Landesarbeitsgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen nicht abschließend beurteilt werden.
I. Die Befristung der Arbeitszeiterhöhung ist eine Allgemeine Geschäftsbedingung iSv. § 305 Abs. 1 BGB und unterliegt der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Schuld-rechts.
1. Der Anwendung der §§ 305 ff. BGB auf die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung steht nicht entgegen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien bereits vor dem 1. Januar 2002 bestanden hat. Nach Art. 229 § 5 EGBGB gilt zwar das bisherige Recht für Dauerschuldverhältnisse, die bereits vor dem 1. Januar 2002 entstanden sind, bis zum 31. Dezember 2002 weiter. Die neuen schuldrechtlichen Bestimmungen sind jedoch anzuwenden auf nach dem 31. Dezember 2001 getroffene Vereinbarungen, die das Schuldverhältnis nachträglich ändern (BAG 27. November 2003 - 2 AZR 177/03 - AP BGB § 312 Nr. 2, zu B I 1 c der Gründe mwN). Dies trifft auf den am 8. Mai 2002 abgeschlossenen Änderungsvertrag zu. In diesem haben die Parteien die befristete Erhöhung der in dem Änderungsvertrag vom 6. September 1993 unbefristet festgelegten regelmäßigen Teilzeit vereinbart und damit den Arbeitsvertrag nachträglich geändert.
2. Die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 getroffene Befristungsabrede ist als Allgemeine Geschäftsbedingung iSd. § 305 Abs. 1 BGB in den Arbeitsvertrag einbezogen worden.
a) Nach § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedingungen alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Ver-
- 9 -
tragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags stellt. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.
b) Hiernach handelt es sich bei der in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarten Befristung der Arbeitszeiterhöhung um eine Allgemeine Geschäftsbedingung.
aa) Der Beklagte hat für den Änderungsvertrag ausweislich der Überschrift des Schriftstücks ein als „Änderungsvertrag für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis“ bezeichnetes Formular benutzt. Bei der Befristungsabrede handelt es sich daher um eine von dem Beklagten vorformulierte Vertragsbestimmung, die er dem Kläger bei Abschluss des Vertrags stellte und der für eine Vielzahl von Verträgen zur schuljahresbezogenen Aufstockung des Stundendeputats von Lehrkräften verwandt wird. Dies hat auch der Beklagte nicht in Abrede gestellt.
bb) Der Beklagte hat die Befristungsabrede nicht im Einzelnen mit dem Kläger ausgehandelt, denn der Kläger hatte nicht die Möglichkeit, vor oder bei Vertragsschluss auf den Inhalt der Befristung Einfluss zu nehmen. Der Kläger hat zwar am 13. März 2002 die befristete Aufstockung seines Stundendeputats für das Schuljahr 2002/2003 um zwei Stunden pro Woche beantragt. Dadurch erhält jedoch die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung nicht den Charakter einer Individualabrede. „Aushandeln“ iSv. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB bedeutet mehr als verhandeln. Es genügt nicht, dass der Vertragsinhalt lediglich erörtert wird und den Vorstellungen des Vertragspartners entspricht. „Ausgehandelt“ iSv. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB ist eine Vertragsbedingung nur, wenn der Verwender die betreffende Klausel inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumt mit der realen Möglichkeit, die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbedingungen zu beeinflussen. Das setzt voraus, dass sich der Verwender deutlich und ernsthaft zu gewünschten Änderungen der zu treffenden Vereinbarung bereit erklärt (BGH 3. November 1999 - VIII ZR 269/98 - BGHZ 143, 104, zu II 2 b aa der Gründe; 3. April 1998 - V ZR 6/97 - NJW 1998, 2600, zu II 2 b der Gründe zu § 1 Abs. 2 AGB-Gesetz; BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv.; 25. Mai 2005 - 5 AZR 572/04 - AP BGB § 310 Nr. 1 = EzA BGB 2002 § 307 Nr. 3, zu VI 1 und VII 2 der Gründe zu § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB). Daran fehlt es im Streitfall.
- 10 -
Der Beklagte war allenfalls bereit, über die Frage zu verhandeln, ob und ggf. in welchem Umfang eine Erhöhung der Arbeitszeit in Betracht kam. Nicht zur Disposition stand jedoch die allein maßgebliche Befristungsabrede. Der Beklagte hat nicht vorgetragen, vor oder bei Vertragsschluss ernsthaft zu einer Änderung der Befristungsabrede bereit gewesen zu sein und dies gegenüber dem Kläger bekundet zu haben.
3. Die Geltung der §§ 305 ff. BGB wird hinsichtlich der Kontrolle der Befristung einzelner Arbeitsbedingungen nicht durch die für die Befristung von Arbeitsverträgen geltenden Bestimmungen in §§ 14 ff. TzBfG verdrängt. Die Vorschriften des TzBfG sind auf die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen nicht anwendbar (BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv., zu B II 1 c der Gründe; 14. Januar 2004 - 7 AZR 213/03 - BAGE 109, 167 = AP TzBfG § 14 Nr. 10 = EzA TzBfG § 14 Nr. 8, zu II 1 b der Gründe).
4. Die Anwendung der §§ 305 ff. BGB wird auch nicht durch die vor In-Kraft-Treten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Kontrolle der Befristung einzelner Arbeitsbedingungen ausgeschlossen. Bei dieser Kontrolle handelte es sich um eine Vertragsinhaltskontrolle. Diese war bis zum 31. Dezember 2001 gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Das gilt auch für die Kontrolle von Arbeitsbedingungen, die in einer Vielzahl von Fällen formularmäßig vereinbart wurden. Denn nach § 23 AGB-Gesetz war dieses Gesetz nicht auf Verträge auf dem Gebiet des Arbeitsrechts anzuwenden. Diese Bereichsausnahme ist mit In-Kraft-Treten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes und der Übernahme des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in das Bürgerliche Gesetzbuch entfallen. Die Vorschriften der §§ 305 ff. BGB in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung über die Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen sind nunmehr auch auf Arbeitsverträge anzuwenden. Die Inhaltskontrolle der nach dem 31. Dezember 2001 in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen vereinbarten Befristung einzelner Arbeitsbedingungen hat deshalb am Maßstab dieser Vorschriften und nicht mehr nach den bis zum 31. Dezember 2001 von der Rechtsprechung im Wege der Rechtsfortbildung entwickelten Grundsätzen zu erfolgen. Die nach dem 31. Dezember 2001 vereinbarte Befristung einzelner Vertragsbedingungen bedarf daher zu ihrer Wirksamkeit nicht mehr eines sachlichen Grundes iSd. bisherigen Rechtsprechung (BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv., zu B II 1 d aa bis cc der Gründe mwN).
- 11 -
5. Die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung der Arbeitszeiterhöhung ist nicht nach § 307 Abs. 3 BGB der Inhaltskontrolle nach dem Recht Allgemeiner Geschäftsbedingungen entzogen.
a) Nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB gelten die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308, 309 BGB nur für Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Das ist bei der Befristung der Arbeitszeiterhöhung der Fall. Es besteht zwar keine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift zur Befristung einzelner Arbeitsbedingungen. Das TzBfG regelt nur die Befristung des gesamten Arbeitsvertrags. Das Fehlen einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung führt aber nicht dazu, dass die formularmäßig vereinbarte Befristung einzelner Arbeitsbedingungen nicht nach §§ 307 ff. BGB zu kontrollieren wäre. Auch Vertragstypen, die gesetzlich nicht geregelt sind, können am Maßstab der §§ 307 ff. BGB gemessen werden (vgl. zu der Vorgängerregelung in § 8 AGB-Gesetz: BGH 23. März 1988 - VIII ZR 58/87 - BGHZ 104, 82, zu II 2 a aa der Gründe). Nach § 307 Abs. 3 BGB sind von der Inhaltskontrolle ausgenommen zum einen deklaratorische Vertragsklauseln, die in jeder Hinsicht mit einer bestehenden gesetzlichen Regelung übereinstimmen. Eine Inhaltskontrolle derartiger Klauseln liefe leer, weil im Falle ihrer Unwirksamkeit nach § 306 Abs. 2 BGB an deren Stelle die inhaltsgleiche gesetzliche Bestimmung träte (vgl. zum AGB-Gesetz: BGH 9. April 2002 - XI ZR 245/01 - BGHZ 150, 269, zu II 1 a der Gründe mwN). Zum anderen unterliegen Abreden, die ihrer Art nach nicht der Regelung durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften unterliegen, sondern von den Vertragsparteien festgelegt werden müssen, nicht der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB (vgl. zum AGB-Gesetz: BGH 19. November 1991 - X ZR 63/90 - BGHZ 116, 117, zu II 1 der Gründe). Dies sind Abreden über den unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistung (sog. Leistungsbeschreibung) und des dafür zu zahlenden Entgelts (st. Rspr., vgl. etwa BGH 6. Februar 1985 - VIII ZR 61/84 - BGHZ 93, 358, zu A II 2 a der Gründe; 19. November 1991 - X ZR 63/90 - aaO; 28. Juni 1995 - IV ZR 19/94 - NJW 1995, 2710, zu I 2 der Gründe) sowie Klauseln, die das Entgelt für eine zusätzlich angebotene Sonderleistung festlegen, wenn hierfür keine rechtlichen Regelungen bestehen (BGH 18. April 2002 - III ZR 199/01 - NJW 2002, 2386, zu III 1 a der Gründe mwN). Der gerichtlichen Kontrolle entzogene Leistungsbeschreibungen sind solche, die Art, Umfang und Güte der geschuldeten Leistung festlegen. Demgegenüber sind Klauseln, die das Hauptleistungsversprechen einschränken, verändern, ausgestalten oder modifizieren, inhaltlich zu kontrollieren. Sie weichen im Allgemeinen von Vorschriften des dispositiven Gesetzesrechts ab oder ihr Regelungs-
- 12 -
gehalt könnte - sofern sie nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten wären - nach §§ 157, 242 BGB ermittelt werden (BGH 6. Februar 1985 - VIII ZR 61/84 - aaO). Im Falle der Unwirksamkeit derartiger Klauseln kann an ihre Stelle die gesetzliche Regelung treten (BGH 19. November 1991 - X ZR 63/90 - aaO). Damit verbleibt für die der Überprüfung entzogene Leistungsbeschreibung nur der enge Bereich der Leistungsbezeichnungen, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht angenommen werden kann (BGH 9. Mai 2001 - IV ZR 121/00 - BGHZ 147, 354).
b) Inwieweit die Änderung von Arbeitsbedingungen allgemein der Inhaltskontrolle unterliegt, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Jedenfalls die befristete Änderung der synallagmatischen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis stellt eine Änderung des Hauptleistungsversprechens dar, die einer Kontrolle nach den §§ 307 ff. BGB unterliegt. Gegenstand der Inhaltskontrolle ist bei der befristeten Erhöhung der Arbeitszeit nicht der vereinbarte Umfang der vom Arbeitnehmer zu erbringenden Arbeitsleistung als Hauptleistungspflicht aus dem Arbeitsverhältnis, sondern dessen zeitliche Einschränkung durch die Befristung. Im Falle der Unwirksamkeit der Befristung ist der Umfang der Arbeitszeit, ebenso wie der gesamte Arbeitsvertrag, für unbestimmte Zeit vereinbart. Bei der Befristung der Arbeitszeiterhöhung handelt es sich daher um eine nach § 307 BGB kontrollfähige Abrede (BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv., zu B II 1 e aa und bb der Gründe).
II. Die bislang getroffenen tatsächlichen Feststellungen lassen eine abschließende Beurteilung der Frage, ob die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung der Arbeitszeiterhöhung der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhält, nicht zu.
1. Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Unangemessen ist jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses des Arbeitnehmers, die nicht durch begründete und billigenswerte Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt ist oder durch gleichwertige Vorteile ausgeglichen wird (BGH 14. Januar 1987 - IV a ZR 130/85 - NJW 1987, 2431; 3. November 1999 - VIII ZR 269/98 - BGHZ 143, 104; 4. Juli 1997 - V ZR 405/96 - NJW 1997, 3022; BAG 4. März 2004 - 8 AZR 196/03 - BAGE 110, 8 = AP BGB § 309 Nr. 3 = EzA BGB 2002 § 309 Nr. 1, zu B III 2
- 13 -
der Gründe). Die Feststellung einer unangemessenen Benachteiligung setzt eine wechselseitige Berücksichtigung und Bewertung rechtlich anzuerkennender Interessen der Vertragspartner voraus. Es bedarf einer umfassenden Würdigung der beiderseitigen Positionen unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Bei der Beurteilung der Unangemessenheit ist ein genereller, typisierender, vom Einzelfall losgelöster Maßstab anzulegen (BAG 4. März 2004 - 8 AZR 196/03 - aaO). Abzuwägen sind die Interessen des Verwenders gegenüber den Interessen der typischerweise beteiligten Vertragspartner. Im Rahmen der Inhaltskontrolle sind dabei Art und Gegenstand, Zweck und besondere Eigenart des jeweiligen Geschäfts zu berücksichtigen. Zu prüfen ist, ob der Klauselinhalt bei der in Rede stehenden Art des Rechtsgeschäfts generell unter Berücksichtigung der typischen Interessen der beteiligten Verkehrskreise eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners ergibt. Werden Allgemeine Geschäftsbedingungen für verschiedene Arten von Geschäften oder gegenüber verschiedenen Verkehrskreisen verwendet, deren Interessen, Verhältnisse und Schutzbedürfnisse unterschiedlich gelagert sind, kann die Abwägung zu gruppentypisch unterschiedlichen Ergebnissen führen. Sie ist innerhalb der Vertrags- oder Fallgruppen vorzunehmen, die nach der an dem Sachgegenstand orientierten typischen Interessenlage gebildet werden (BAG 4. März 2004 - 8 AZR 196/03 - aaO).
Eine unangemessene Benachteiligung ist nach § 307 Abs. 2 BGB im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist (Nr. 1) oder wenn die Bestimmung wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (Nr. 2). § 307 Abs. 2 BGB konkretisiert § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. Liegen die Voraussetzungen des § 307 Abs. 2 BGB vor, wird eine unangemessene Benachteiligung vermutet.
2. Anhand der bisherigen tatsächlichen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob nach diesen Grundsätzen der Kläger als Lehrkraft des Beklagten durch die in dem Änderungsvertrag vom 8. Mai 2002 vereinbarte Befristung der Arbeitszeiterhöhung um zwei Unterrichtsstunden pro Woche für die Dauer eines Schuljahres entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt wird.
Die Voraussetzungen der in § 307 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB geregelten Vermutungstatbestände liegen nicht vor. Gesetzliche Regelungen über die Befristung
- 14 -
einzelner Arbeitsbedingungen, von denen die Befristungsabrede abweichen könnte, bestehen nicht. Durch die Befristung der Arbeitszeiterhöhung wird die Erreichung des Vertragszwecks nicht gefährdet. Die Inhaltskontrolle der Befristungsabrede hat daher nach der allgemeinen Regelung in § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB zu erfolgen. Danach ist anhand einer umfassenden Bewertung der rechtlich anzuerkennenden Interessen bei-der Vertragspartner unter Berücksichtigung von Treu und Glauben zu ermitteln, ob der Kläger als Lehrkraft des Beklagten durch die Befristung der Arbeitszeiterhöhung unangemessen benachteiligt wird. Diese Bewertung ist dem Senat nicht möglich, da das Landesarbeitsgericht bislang nicht festgestellt hat, ob dem Beklagten ein schutzwürdiges, rechtlich anzuerkennendes Interesse an der jeweils für ein Schuljahr befristeten Aufstockung des Stundendeputats mit den von ihm teilzeitbeschäftigten Lehrkräften zuzubilligen ist, das dass Interesse der betroffenen Lehrkräfte an der unbefristeten Vereinbarung des Beschäftigungsumfangs überwiegt. Der Senat hat dies hinsichtlich der für ein Schuljahr befristeten Erhöhung des Stundendeputats von Lehrkräften in einem anderen Bundesland auf Grund der Besonderheiten im dortigen Schulbereich bejaht (BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv.). Dabei hat der Senat betont, dass allein die Ungewissheit über den künftigen Arbeitskräftebedarf nicht aus-reicht, um die Befristung von Arbeitszeiterhöhungen zu rechtfertigen, da diese Ungewissheit zum unternehmerischen Risiko gehört, das nicht auf die Arbeitnehmer verlagert werden kann. Dieser Grundsatz gilt auch für die nach §§ 307 ff. BGB vorzunehmende Inhaltskontrolle arbeitsvertraglicher Vereinbarungen (27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - aaO, zu B II 2 b bb (2) der Gründe; vgl. auch BAG 12. Januar 2005 - 5 AZR 364/04 - AP BGB § 308 Nr. 1 = EzA BGB 2002 § 308 Nr. 1, zu B I 4 c bb der Gründe). Obwohl in jenem Fall eine derartige Unsicherheit bestand, hat der Senat die Befristung der Arbeitszeiterhöhung von Lehrkräften für die Dauer eines Schuljahres für wirksam gehalten, weil die Befristung Teil eines Gesamtkonzepts war, das dazu diente, einem auf Grund rückläufiger Schülerzahlen eingetretenen Lehrerüberhang zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen zu begegnen. Zu diesem Zweck wurden auf der Grundlage einer mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie mehreren Pädagogenverbänden getroffenen Koalitionsvereinbarung mit den vorhandenen Lehrkräften Teilzeitbeschäftigungen vereinbart, verbunden mit der Möglichkeit, den Arbeits-umfang im Bedarfsfall schuljahresbezogen befristet aufzustocken. Der Aufstockungs-bedarf wurde jeweils schuljahres- und schulstufenbezogen von der Schulverwaltung des Landes ermittelt. Anschließend wurden den betroffenen Lehrkräften entsprechende Aufstockungsangebote unterbreitet. Für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung wurde
- 15 -
mit den Lehrkräften der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vertraglich vereinbart. Diese Vertragsgestaltung ermöglichte es, die Arbeitsverhältnisse der Lehrkräfte zu erhalten, den verringerten Beschäftigungsbedarf auf diese zu verteilen und eine kontinuierliche Unterrichtserteilung durch bewährte und eingearbeitete Lehrkräfte auch bei vorübergehend ansteigendem Unterrichtsbedarf zu gewährleisten. Aus diesem Konzept, das auch die Interessen der betroffenen Lehrkräfte berücksichtigte, ergab sich ein berechtigtes Interesse des Landes daran, mit den Lehrkräften die jeweils für ein Schuljahr befristete Aufstockung des Unterrichtsdeputats vereinbaren zu können. Ob in der Schulverwaltung des Beklagten vergleichbare oder andere Besonderheiten bestehen, aus denen sich ein berechtigtes Interesse des Beklagten an der für ein Schuljahr befristeten Aufstockung des Beschäftigungsumfangs der Lehrkräfte ergibt, kann mangels der dazu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen nicht beurteilt wer-den. Bislang ist nicht festgestellt, ob und ggf. nach welchen Kriterien der Beklagte die befristete Aufstockung des Unterrichtsdeputats mit den betroffenen Lehrkräften vereinbart und ob für die Vertragsgestaltung ein nachvollziehbares Konzept vorliegt. Anders als in dem vom Senat am 27. Juli 2005 (- 7 AZR 486/04 - NZA 2006, 40, zVv.) entschiedenen Rechtsstreit ergibt sich ein solches Konzept nicht ohne weiteres aus der mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am 15. Juni 1992 abgeschlossenen Koalitionsvereinbarung, da diese die Möglichkeit der für ein Schuljahr befristeten Aufstockung des Unterrichtsdeputats nicht vorsieht. Außerdem erscheint zweifelhaft, ob die im Jahr 2002 mit den Lehrkräften abgeschlossenen Änderungsverträge im Zusammenhang mit der im Jahr 1992 getroffenen Koalitionsvereinbarung stehen. Dies begegnet schon deshalb Zweifeln, weil der Umfang der nach der Koalitionsvereinbarung im Jahr 1992 unbefristet vereinbarten Teilzeitbeschäftigung bereits im Jahr 1993 unbefristet erhöht wurde, wie der Fall des Klägers zeigt. Möglicherweise ergeben sich ergänzend zu der Koalitionsvereinbarung oder unabhängig von dieser aus dem von dem Beklagten erwähnten „Schulkompromiss“ aus dem Jahr 2000 - oder aus anderen Umständen - Gesichtspunkte, die ein berechtigtes Interesse des Beklagten an der be-fristeten Aufstockung des Unterrichtsdeputats der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte begründen können. Dies ist vom Landesarbeitsgericht aufzuklären. Dazu wird den Parteien zunächst Gelegenheit zu weiterem Sachvortrag zu geben sein. Anschließend wird das Landesarbeitsgericht die erforderlichen Tatsachen festzustellen und im Wege einer Gesamtwürdigung sämtlicher berechtigter Belange des Beklagten und der betroffenen Lehrkräfte zu bewerten haben, ob die Lehrkräfte durch die Befristung der Arbeitszeiter-
- 16 -
höhung für die Dauer eines Schuljahres entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt werden.
III. Die weitere Sachaufklärung erübrigt sich nicht deshalb, weil die Befristung der Arbeitszeiterhöhung auf Wunsch des Klägers vereinbart worden wäre und schon deshalb eine unangemessene Benachteiligung zu verneinen wäre. Die Befristung der Arbeitszeiterhöhung beruhte entgegen der Auffassung des Beklagten nicht auf dem Wunsch des Klägers. Das wäre nur der Fall, wenn Umstände vorlägen, aus denen geschlossen werden könnte, dass der Kläger die Aufstockung des Unterrichtsdeputats auch dann nur befristet vereinbart hätte, wenn ihm die unbefristete Aufstockung angeboten worden wäre. Derartige Umstände sind nicht festgestellt und vom Beklagten nicht vorgetragen worden.
IV. Da der Senat nicht abschließend beurteilen kann, ob die Befristung der Arbeitszeiterhöhung zum 31. Juli 2002 wirksam ist, war die anzufechtende Entscheidung auch insoweit aufzuheben, als das Landesarbeitsgericht die Berufung des Beklagten gegen den vom Arbeitsgericht ausgeurteilten Weiterbeschäftigungsanspruch zurückgewiesen hat.
C. Das Landesarbeitsgericht hat im Rahmen der neuen Entscheidung auch über die Kosten der Revision zu befinden.
Dörner
Gräfl
Koch
Gerschermann
Busch
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |